Hypertrophie
Hypertrophie bezeichnet ganz allgemein die Größenzunahme von Organen und Gewebe durch Vergrößerung der Zellen. Die Hyperplasie dagegen bezeichnet eine Vermehrung der Anzahl der Zellen. Bezogen auf den Kraftsport bezieht sich der Begriff Hypertrophie auf das Wachstum der Muskelzellen (Muskelhypertrophie).
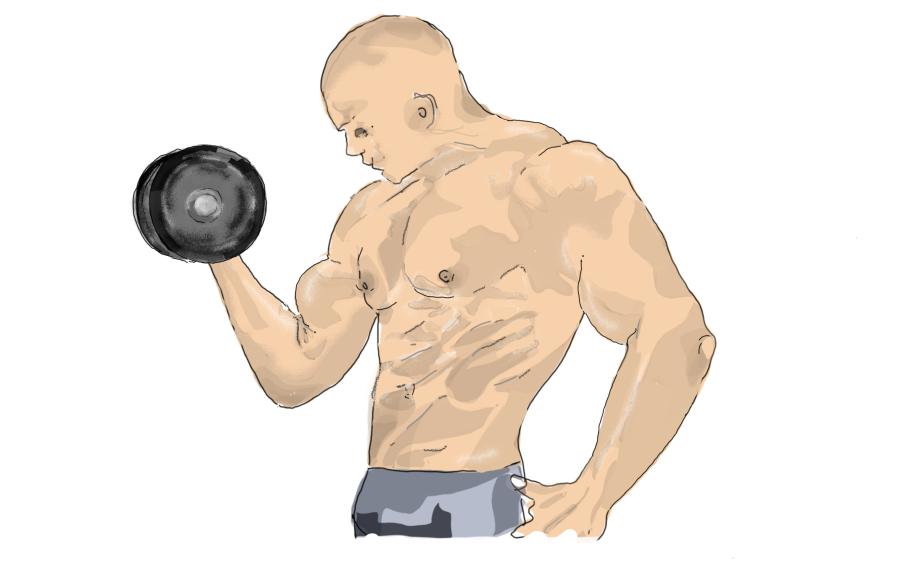
facts
- Hypertrophie bedeutet Größenzunahme - Muskelhypertrophie ist das Dickenwachstum der Muskelfasern
- Muskelwachstum basiert auf mechanischer oder metabolischer Beanspruchung
Was ist Muskelhypertrophie
Muskelhypertrophie ist das Dickenwachstum der einzelnen Muskelfasern, nicht jedoch die Erhöhung der Anzahl an Muskelfasern. Ob durch Krafttraining auch die Anzahl der Muskelfasern erhöht wird, konnte noch nicht bewiesen werden.
Die Muskelfaser besitzt ein Leistungsniveau und ist dabei so groß, wie sie sein muss. Erst wenn es zu einer bestimmten Beanspruchung der Muskelfasern (Wachstumsreiz) kommt, führt dies zur Vergrößerung des Muskelquerschnitts durch Einlagerung von Proteinen.
Die Muskelfaser ist streng genommen eine Muskelzelle mit mehreren Zellkernen (polyenergid) und Bestandteil eines Muskels. Jeder einzelne Zellkern ist für sich unabhängig und besitzt einen eigenen Einflussbereich. Man bezeichnet diesen als MND (myonukleare Domäne).
Es existieren zwei Stoffwechselvorgänge der Hypertrophie.
- Mechanische Reize (Aktivierung durch Mikrotraumata)
- Metabolisch Reiz (Sauerstoffdefizite, Laktatbildung)
Hypertrophietraining
Hypertrophietraining ist eine Form des Krafttrainings mit dem Ziel den Muskelquerschnitt bestmöglich zu vergrößern. Wichtig ist dabei in erster Linie, dass der Muskel bis zur annähernden völligen Erschöpfung belastet wird.
Bis zur Erschöpfung!
Der Aufbau von Muskelmasse erfolgt nur, wenn der Trainingsreiz ausreichend hoch (bis zur Erschöpfung erfolgt).
Was genau passiert im Körper?
Richtiges Krafttraining führt zu einem Muskelaufbau, das ist klar und einfach zu belegen. Was dabei genau im Körper passiert, ist extrem komplex und noch nicht vollständig geklärt. Mittels Magnetresonanztomografie und Dual-Röntgen-Absorptiometrie konnte jedoch ein wenig Licht ins Dunkle gebracht werden.
Achtung, jetzt wird es etwas wissenschaftlich!
Durch gezieltes Krafttraining (Muskelaufbau) vergrößert sich der MND durch Einlagerung von Proteinen.
Eine Beanspruchung der Muskulatur führt zu kleinsten Verletzungen (Mikrotraumata) der Zellen und bewirkt dadurch eine Steigerung der Proteinbiosyntheserate und Fusionierung von Satellitenzellen mit Muskelzellen, mit der Folge einer Zunahme der DNA in der Zelle.
Diese Mikroverletzungen bewirken eine Produktion des sog. IGF-1Ec, welches nach außen dringt und dadurch die Satellitenzellkaskade in Gang setzt.
Die Satellitenzellen (Myoblasten) befinden sich in der Nähe der Muskelzellen und werden durch Stoffwechselprozesse aktiviert und bewegen sich in Richtung der Verletzung der Zellmembran und fusionieren dort mit der Muskelzelle und geben den Zellkern an die Muskelzelle ab.
Es entstehen neue MND’s mit Hypertrophiepotential.
Kurz!
Krafttraining bewirkt eine Art Mikroverletzung der Muskulatur. In der anschließenden "Reparaturphase" wird die Muskulatur über das Ausgangsniveau aufgebaut.
Wie erreicht man Muskelhypertrophie?
Es gibt mehrere Faktoren, die bei der Muskelhypertrophie eine Rolle spielen:
- Richtiges Training
- Ernährung
- Genetische Voraussetzung
- Hormonhaushalt
1. Richtiges Krafttraining
Ganz klar, das Krafttraining ist der entscheidende Faktor, wenn es um Muskelaufbau geht. Aber wie genau sollte man trainieren.
Eine Studie aus dem Jahre 2016 von Morton et al. kam zu dem Ergebnis, dass nicht die Wiederholungszahl entscheidend ist für einen optimalen Muskelaufbau, sondern die Erschöpfung der Muskulatur.
Demgegenüber stehen jedoch einige Studien, die aufzeigten, dass Krafttraining mit höheren Gewichten zu einem größeren Muskelwachstum führten.
Das Ergebnis aller Studien ist jedoch immer, der Muskel muss beim Training bis zur Erschöpfung belastet werden.
Eine Wiederholungszahl mit 5-8 Wiederholungen bei einer Intensität von ca. 80% der 1RM (1-Wiederholung-Maximum) mit 3 Sätzen pro Übung und einer Pausenlänge von ca. 2 Minuten hat sich in der Trainingspraxis etabliert.
Das Trainingsgewicht sollte dabei so hoch gewählt werden, dass keine weitere Wiederholung mehr möglich ist.
2. Ernährung
Wie bereits oben beschrieben, kommt es beim Aufbau von Muskulatur zu einem Einlagern von Proteinen in die Muskelzelle. Man spricht dabei von einem Baustoffwechsel. Damit dieser Aufbau stattfinden kann, muss über die Ernährung ausreichend Protein aufgenommen werden.
Zudem benötigt man für den Aufbau von Muskulatur einen Kalorienüberschuss. Das bedeutet, Du musst mehr Kalorien über die Nahrung aufnehmen, als Du über den Tag verteilt verbrennst.
3. Genetische Voraussetzung
Jeder Mensch besitzt eine unterschiedliche Voraussetzung, um Muskeln aufzubauen. Entscheidend sind dabei die Art der Muskelfasern. Es gibt TYP1 Muskelfasern, die für Ausdauerbelastung verantwortlich sind und TYP2 Muskelfasern, die für schnelle und kräftige Bewegung verantwortlich sind.
Menschen mit vermehrter Anzahl von TYP2 Muskelfasern haben beim Krafttraining einen klaren Vorteil.
4. Hormonhaushalt
Neben der äußeren Einwirkung durch mechanischen Reize (Krafttraining) kann ein Muskelaufbau auch künstlich durch die Einnahme von anabolen Hormonen angeregt werden. In der Regel werden diese Hormone in der medizinischen Therapie und im Doping angewandt.
Hauptvertreter ist das männliche Geschlechtshormon Testosteron. Testosteron besitzt einen Muskel aufbauenden Effekt, daher bauen Männer schneller und mehr Muskeln auf als Frauen.